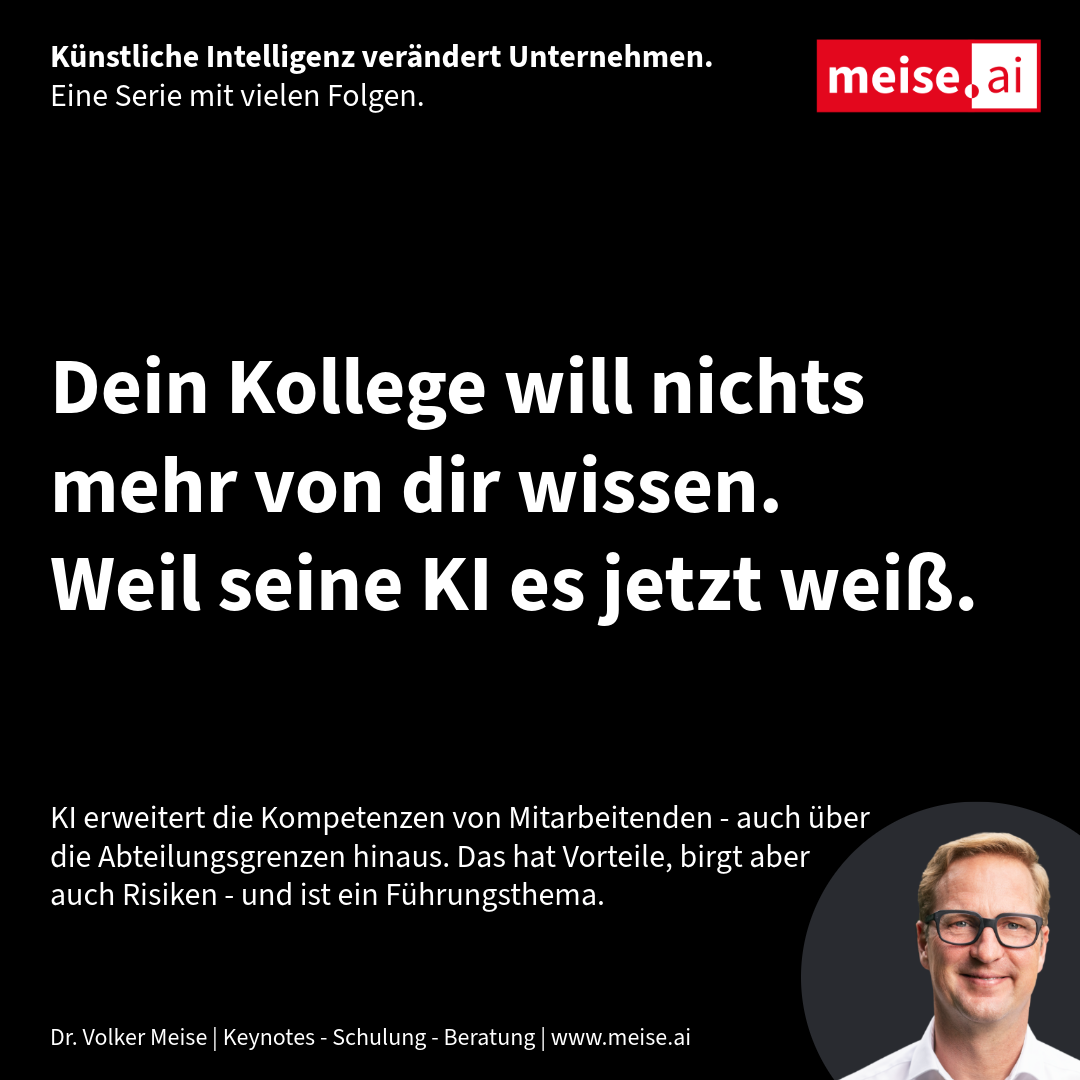Stell dir vor, deine vertrauteste Kollegin kommt plötzlich nicht mehr zu dir.
Nicht, weil ihr euch gestritten habt. Sondern weil ihre KI jetzt das liefert, wofür sie früher dich brauchte.
Genau hier liegt die stille Revolution in Unternehmen: KI verschiebt Abhängigkeiten und damit Machtverhältnisse. Wer KI einsetzt, erweitert sein Spielfeld. Aufgaben, die bisher Spezialwissen oder die Unterstützung anderer Abteilungen erforderten, lassen sich nun direkt erledigen – von der Analyse bis zum fertigen Konzept.
Das verändert die Beziehungen innerhalb der Organisation.
❎ Weniger Nachfrage bei Kolleg:innen bedeutet weniger Austausch, weniger Wissenstransfer.
❎ Arbeitsergebnisse sehen anders aus, weil Expertise nicht durch KI ersetzt, sondern überlagert wird. Vorschriften, Standards oder Abstimmungen können dabei leicht unter den Tisch fallen.
❎ Auch externe Dienstleister verlieren an Bedeutung, wenn intern plötzlich mehr selbst erledigt wird.
Oberflächlich wirkt das wie ein Effizienzsprung. Für die einzelne Person stimmt das sogar: Mit KI lassen sich Aufgaben schneller und breiter bearbeiten. Doch für die Organisation als Ganzes ist die Rechnung längst nicht aufgegangen. Weniger Vernetzung kann auch weniger Qualität, weniger Kontrolle und weniger gemeinsame Verantwortung bedeuten.
Damit sind Führung und HR gefragt. Nicht, um KI-Einsatz zu bremsen, sondern um neue Spielregeln für Zusammenarbeit zu etablieren. Denn wenn Vertrauen und Rollenverständnis wegbrechen, dann verliert das Unternehmen mehr, als durch individuelle KI-Power gewonnen wird.
KI ist damit nicht nur Werkzeug. Sie ist ein Machtfaktor im Inneren von Organisationen – und wer das ignoriert, riskiert mehr Unruhe als Nutzen.